Ceci n’est pas un coup

Ceci n’est pas un coup
Die normative Kraft des Post-Faktischen (im Licht kritischer Semiotik)
von Felix Reidenbach
„Propaganda ist nicht, wenn gelogen wird — das ist Lügen. Natürlich können Lügen Propaganda sein, aber nicht, wenn sie geglaubt werden — sie erscheinen dann einfach als Nachrichten. Propaganda ist, wenn so auffallend offen gelogen wird, dass eine Mitteilung nicht einmal als der Versuch einer Glaubhaftmachung glaubwürdig erscheint. Propaganda geht es nicht mehr um blinde Gefolgschaft als um sehende. Der Regelverstoß offene Lüge propagiert als dessen Kostprobe den Regelverstoß unmittelbar und schlechthin.“
aus: die niedlichen, „Natographie“, Spex, Juni 1999
Bereits während des US-Wahlkampfs 2016 begann der Talkshow-host Bill Maher, das Agieren Trumps und seiner enabler als „slow-motion coup“ zu bezeichnen.
Maher wollte seine Wortwahl ausdrücklich nicht metaphorisch verstanden wissen — nicht als satirische Überzeichnung eines lediglich kulturellen Skandals einer grotesken Kandidatur. Er meinte die Einstufung „Staatsstreich“ im rechtlichen Sinne ernst.
In vielen öffentlichen Auftritten hatte Trump angekündigt, ein Anerkennen des Wahlergebnisses von seinem Sieg abhängig zu machen („only if I win“); hatte er angedroht, als Präsident seine Gegenkandidatin inhaftieren lassen zu wollen; hatte er gegen diese über Monate Faustrecht-Sprechchöre angefacht („lock her up“); hatte er seine base dazu angeregt, bei Wahlverlust zu den Waffen zu greifen („‚second amendment people‘ could stop Clinton“); sowie Rechtsbrechern in seiner Anhängerschaft zugesagt, ihnen legal-fee-Beihilfen zu gewähren. Angesichts dieser und ähnlicher Äußerungen konnte seine Absicht zum Systemumsturz als unmissverständlich kundgetan gelten.
Doch auch die anschließenden vier Jahre demonstrativer Lügen, Normen- und Gesetzesbrüche reichten für Politik und Nachrichten-Medien nicht aus, untertreibende Beschreibungen der Intentionen Trumps und seiner Partei endgültig aufzugeben – nicht einmal die Ende 2020 offen unternommenen Wahlfälschungsversuche vermochten das. Während zwar einerseits das Entsetzen über Präsident und Partei immer nur gewachsen war, war andererseits immer noch und immer wieder der „feste Glaube“ an die „Stabilität der Institutionen“ der „ältesten Demokratie der Welt“ beschworen worden.
Dann kam die Erstürmung des Capitols.
Und sogar nach diesem Live-Stream-Angriff auf die oberste Gesetzgebungseinrichtung der USA durch gewalttätige Trump-Anhänger (sowie mutmaßlich republikanische Kongressmitglieder und Teile des Sicherheitsapparates) wählten Vertreter*innen von Politik und Medien noch tagelang moderate Worte — sowohl in den USA als auch in Deutschland, insbesondere im TV.

In einer paradoxen Mischung aus akuter Fassungslosigkeit und chronischer Abgestumpftheit verharmlosten viele Berichte und Kommentare den Umsturzversuch zunächst als breach, trespassing, protest, riot, uproar — als Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Unruhe, Aufstand. Selbst der zwischenzeitlich favorisierte Ausdruck „Terroranschlag“ war im Grunde eine Bagatellisierung: Terroranschläge sollen Angst verbreiten und destabilisieren — sie führen aber in aller Regel keine schlüsselfertige Diktatur im Gepäck. Und tun sie es doch, dann sind sie eben das, wovor Bill Maher und andere seit Jahren gewarnt hatten: Ein versuchter Staatsstreich, ein „coup d‘état“.
Erst nach und nach setzte es sich in der Breite der politischen Kommentare durch, die Capitol-Erstürmung mit eben den Begriffen zu bezeichnen, die in Verfassung, Gesetzen und anderen Rechtstexten für Vergehen dieser Dimension vorgesehen sind, und anhand derer angemessene strafrechtliche Konsequenzen deshalb überhaupt erst verhandelbar werden: insurrection, sedition, overthrow, coup und, ja, conspiracy.
Nun kann man die verbale Zurückhaltung vieler Medien als den Versuch werten, der jahrelangen, gerade auch von höchster Regierungsstelle aus aufhetzenden Rhetorik, unbeirrt eine verantwortungsbewusste, abgerüstete Kultur des Besprechens entgegenzusetzen. Man kann darin aber auch ein gefährliches und fragwürdig motiviertes underselling sehen.

Denn wenn tatsächlich Feuer gelegt wird, ist die Verwendung des Wortes „Brandstiftung“ keine Stilfrage mehr. Wenn Parlamentsgebäude gestürmt werden, wie in Berlin, Michigan, Washington, ist „Staatsstreich“ keine illegitime Übertreibung mehr, sondern die legal dafür vorgesehene Bezeichnung.
Demokratische Rechtsstaaten benutzen in ihren Rechtstexten den Ausdruck „coup“ oder bedeutungsverwandte Begriffe wie „sedition“, „overthrow“, „Landfriedensbruch“, „Gefährdung der Ordnung“ aus zwei wichtigen Gründen.
Zum einen natürlich, um Fälle unrechtmäßigen Machterwerbs zu benennen und Strafen für sie vorschreiben zu können — wie z. B. U.S. Code §2384, der den Begriff „seditious conspiracy“ in einer ganzen Liste von Anwendungsbedingungen aufschlüsselt, ganz offensichtlich um bei der Definition dieses staatsexistenziell entscheidenden Tatbestands möglichst alle nur erdenklichen Auslegungen abzudecken.
Zum anderen aber auch, um Fälle von staatlichem Machtmissbrauch auszuschließen, etwa durch Notstandsgesetze, wie z. B. Artikel 16 der französischen Verfassung oder Artikel 20 des deutschen Grundgesetzes, welcher für diesen Fall jeder deutschen Einzelperson „das Recht zum Widerstand“ garantiert. Selbst der berüchtigte zweite Zusatzartikel der US-Verfassung, der alle Bürger zum Waffentragen berechtigt, tut dies ausdrücklich ausschließlich zu dem Zweck, sie einen freien Staat sichern zu lassen.
Das heißt: In Rechtsstaaten sollen Gesetze, die Tatbestände von Umsturzbestrebungen beschreiben, Staatsvertreter und übrige Bürger in beiden Richtungen voreinander schützen.
Dieses gleichberechtigende Verhältnis von Staat und Angehörigen festzuschreiben, ist bekanntlich historisch eine große Errungenschaft gewesen — wenn man so will, der judicial turn der Aufklärung (in all seiner technokratischen Dialektik).
Ein turn, weil Begriffe, die die Angehörigen einer Rechtsgemeinschaft zuvor in privilegierte Herrschende und unter-privilegierte Beherrschte eingeteilt hatten, nun immerhin de jure, in Verfassungen und anderen Gesetzesschriften, nicht mehr als gebotene Positiv-, sondern nur noch als verbotene Negativ-Tatbestände festgeschrieben wurden. Vielleicht am deutlichsten formuliert ist diese rechtliche Wende im Gewähren eines geheimen, freien, gleichen Wahlrechts — das allerdings in Ländern mit Mehrheitswahlrecht wie den USA oder GB noch immer eklatant unvollkommen ist.
Politisch-rechtlich liegt die Errungenschaft gesetzlicher Bezeichnungen von Machtwillkür also schlicht darin, jegliche Ständeordnungen abzuschaffen und sie durch möglichst gleichberechtigende Demokratie-Strukturen zu ersetzen.
Kulturell aber liegt die Errungenschaft darin, zu unterscheiden zwischen alltagsgebräuchlichen, entsprechend unscharfen, von jedermann* beliebig dehnbaren Begriffsverwendungen, und solchen, die an bestimmte, wissenschaftsmethodisch legitimierte, institutionell legalisierte Verfahren des Definierens und Begründens gekoppelt werden müssen. Nur so lässt sich in hochnormativen, potentiell besonders folgenschweren Diskursen eine Teilung der sozusagen symbolischen Gewalten Kultur und Recht einigermaßen transparent gewährleisten, (wie ausdrücklich reflektiert ist im Verständnis freier Medien als eine nicht-staatliche, „vierte Gewalt“).
Die politische Diskurspraxis der Nach-Aufklärung versucht mithin idealerweise, permanent den (sozial-)epistemischen Umstand zu reflektieren:
Begriffe der Kultur verhalten sich zu Begriffen des Rechts wie Objektsprache zu Metasprache (im Sinne von Russell und Tarski).
Objektsprache: „Bücher sind das Gedächtnis der Menschheit.“
Metasprache: „‚Bücher‘ ist der Plural-Nominativ von ‚Buch‘.“
Weil man sich nicht auf diesen beiden Sprachebenen zur selben Zeit bewegen kann, ist es bei Diskussionsbeiträgen zu Politik und Gesellschaft verständnisentscheidend, deutlich zu machen, auf welche Ebene man gerade einzuwirken beabsichtigt.
Insbesondere nachrichtenjournalistische, wissenschaftliche, gutachterliche oder gesetzeskommentierende Texte müssen klar benennen, ob sie entweder (essayistisch) die umgangsprachliche Verwendung eines Begriffes übernehmen bzw. kritisieren wollen, oder sich auf die inhärente Systematik seiner rechtlich festgelegten Bedeutung beziehen.
In den schönen Künsten oder im Kulturjournalismus, als einer Grauzone zwischen beliebiger Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit, mag das unreflektierte Springen zwischen diesen Ebenen noch vertretbar sein, um einen Beitrag vielleicht emotionaler, wirkungsvoller zu machen.

Da allerdings beginnen dann bereits die Risiken des overselling — die andere Seite der diskursethischen Medaille. Und dieser Seite werden seit Jahren immer höhere Nennwerte eingehämmert.
Mit dem Aufstieg der social media hat der inflationär-aufblasende Gebrauch juristischer Negativ-Begriffe stark zugenommen — nicht selten in bedenklichen Schnittmengen von links und rechts.
„Lüge“, „Betrug“, „Täter“, „Opfer“, „Fälschung“, „Täuschung“, „Zensur“, „Freiheitsberaubung“, „Verrat“, „Gewalt“ und nicht zuletzt „Verschwörung“ — das alles sind keine beliebig gewählten Ausdrücke der Alltagskultur, sondern juridifizierende Begriffe, mit denen in allen Teilen des politischen Raums täglich rhetorische Selbstermächtigung betrieben wird.
Je häufiger aber Schlagworte wie diese dem Recht entlehnt werden, desto mehr wird eine Kultur der Selbstjustiz normalisiert.
Zu dieser regressiven Kultur gehört die dauernde Selbst-Viktimisierung der „Beherrschten“, die herrschende Verhältnisse nicht mehr als veränderbar darstellt, sondern nur noch als zerstörenswert.
Von einem angeblich ordnungskritischen Standpunkt aus inflationär alles mögliche z.B. unter „Gewalt“ zu subsumieren, ohne die rechtlichen Bedeutungen dieses Begriffes im Blick zu behalten, entwertet dessen Sinn ebenso wie die deflationäre Weigerung jeweiliger Ordnungsbefürworter, ihn auf Taten anzuwenden, die alle gesetzlich dazu definierten Bedingungen erfüllen.
Dabei liegt es sozusagen in der Natur von Kultur, dass dem Recht vor allem solche Schlagworte entwendet werden, die überhaupt massenmedial halbwegs popularisiert sind — Begriffe für Grundrechte bzw. deren Verletzung — also die für eine demokratisch verfasste Rechtsgemeinschaft wertvollsten Begriffe, da die Einklagbarkeit ihrer Bedeutungen, wie gesagt, historisch unter vielen schlimmen Opfern errungen werden musste.
Zwischen Übertreibung und Untertreibung einen gangbaren Weg der Auseinandersetzung zu finden, ist eine dauernde Gratwanderung — und zudem eine, die durch den Nebel je aktueller Konflikte und unüberschaubarer Eskalationen oft zusätzlich erschwert ist.

Der übertreibende und inflationäre Gebrauch schwergewichtiger Rechtsbegriffe ist aber nicht nur problematisch, weil er in rhetorischem Überbietungswettkampf Tendenzen zur Radikalisierung befeuert. Er lenkt auch von unscheinbareren, tatsächlich zur Skandalisierung geeigneten Gesetzeslücken und Justizversäumnissen ab — und von Allgemeinerem, das sich an diesen verstehen ließe.
Wieso zum Beispiel war es dem abgewählten Präsidenten und seinen Verbündeten eigentlich erlaubt, das Wahlergebnis gerichtlich überprüfen zu lassen und es gleichzeitig weiter öffentlich zu bestreiten? Das Recht zum Prüfenlassen müsste doch vernünftigerweise an die Pflicht gekoppelt sein, das Prüfergebnis als vorläufig offen anzuerkennen. Hätten die mit der Wahl betrauten Behörden oder auch beliebige US-Bürger nicht Trump und seinen Anwalt Giuliani auf zumindest einstweiliges Unterlassen unbewiesener Behauptungen verklagen können müssen? Jeder Sprudelabfüller könnte derart massive Falschbehauptungen über sein Produkt unterbinden lassen, wie Trump sie über das Gemeinschaftsprodukt „demokratische Wahl“ monatelang in die Welt setzte. Mangels eines solchen Verbots durfte ununterbrochen weiter Stimmung zum „Zurückholen des Landes“, zum Umsturz gemacht werden, und wurde auch diese Kampagne mit einer pseudo-juristischen Parole aufgepumpt: „Stop the steal“.
Erst drei Wochen nach der unter dem Geschrei dieser Parole verübten Erstürmung des Capitols wurde vermeldet, dass es wenigstens einer Person doch noch gerichtlich untersagt werden könnte, das längst rechtskräftige Ergebnis der US-Wahl weiter als Fälschung zu bezeichnen. Das Unternehmen Dominion Voting Systems verklagte Rudy Giuliani auf Unterlassung und Schadenersatz in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar. In den marktradikalen USA können offenbar selbst Staatsstreichversuche nur bekämpft werden, wenn sie sich in einen privatwirtschaftlichen Schaden übersetzen lassen — sprich: wenn sich ihr Preis beziffern lässt.
Der Fall weist aber nicht nur auf diskussionsbedürftige Schwächen des geltenden Rechts hin. Er macht allgemein anschaulich, welche Faktoren in das betriebssystemische Prozessieren von Normen und Regeln involviert sind.
Er präzisiert, wie das genau funktioniert: der Austausch zwischen Objektsprache und Metasprache, der Übergang von kulturell wildwuchernden zu institutionell legalisierten Sprechakten (und zurück).
Denn zum Verständis von Verrechtlichung ist die zweiteilige Unterscheidung Objektsprache / Metasprache natürlich unvollständig. Logischerweise ist noch eine dritte Komponente immer vorgelagert:
Objekt / Objektsprache / Metasprache
Das „Objekt“ wären im genannten Fall die Wahlmaschinen bzw. deren Benutzungshandlungen durch Wahlhelfer und Wahlaufseher. Strittig wird sein, ob die Bauweise der Maschinen bzw. ihre Bedienung — gemessen an metasprachlich festgeschriebenen Regeln — vorschriftsgemäß oder vorschriftswidrig erfolgte — und ob also die objektsprachliche Behauptung der Manipulation entweder den metasprachlich formulierten Tatbestand „zulässige Meinungsäußerung“ erfüllt, oder als „üble Nachrede“ bzw. gar als „Verleumdung“ zu werten ist.

Verallgemeinert betrachtet: Offenbar kann Metasprache nicht aus ihrer Beziehung allein zur Objektsprache diese zum Gegenstand rechtlicher Einordnungen machen, sondern sie braucht zudem eine eigene Beziehung zum Objekt der Objektsprache — sozusagen einen eigens verrechtlichenden Meta-Objektbezug.
Diesen Meta-Objektbezug anzugreifen, ist eine zentrale, zunehmend eingesetzte Taktik der extremen Rechten.
Sie unternehmen alles, um in den endlosen Streits um „evidence“ — in Gerichten, Parlamenten, Medien — jeden Meta-Objektbezug in einen infiniten Regress ontologischer (Un-)Beweisbarkeit zu stürzen. Nähme man diese Taktik genauer unter die Lupe, ließe sich wahrscheinlich nachweisen, dass die Rechten sich virtuos der gesamten Klaviatur transzendentalphilosophischer Subdifferenzierungen bedienen, um das „Objekt“ zwischen seinen vielen Aspekten als „Referent“, „Denotat“, „Perzept“, „mentales Konzept“, „Sinnesphänomen“, „Ding an sich“, „realer Gegenstand“ unbegreifbar zu machen und letztlich verschwinden zu lassen. Zitat Trump: „What you’re seeing and what you’re reading is not what’s happening.“
So auch im zweiten Impeachment-Verfahren, in dem Trumps Rally-Video vom 6. Januar als ein wesentliches Beweis-Objekt fungiert. Zur Verteidigung angeführt wird jede semantisch nur denkbare Art von Gegenbehauptung:
„Hat Trump nicht gesagt / hat Trump nicht so gesagt / hat Trump nicht dann gesagt / hat Trump nicht nur gesagt / hat Trump nicht so gemeint / hat Trump vorher klargestellt / hat Trump nachher klargestellt“ usw.

In der Kette „Objekt / Objektsprache / Metasprache“ entsteht Verrechtlichung also nicht nur durch die sprachliche Beziehung der letzten beiden Komponenten (OS-MS), sondern zugleich auch durch die Beziehung der ersten zwei (O-OS) sowie der ersten zur dritten (O-MS). Und das Erschüttern einer Rechtsordnung erfolgt im „Normalisieren“ zuvor ausgeschlossener Varianten dieser drei Beziehungen — im normativen Verstetigen rechter (oder auch linker), non-verbaler und verbaler Gegenkulturen.
Zu den historischen Aspekten dieses dauernden Ineinanderübergehens und Aneinandergeratens von Kodierung und Kodifizierung ließen sich Unmengen erhellender Beispiele finden:
- zunächst in den „Objekten“ non-verbaler Kultur, also den Referenten der Objektsprache (O-OS), die auf der Meta-ebene in je eigenen Rechtsgebieten wiederkehren in Gestalt methodisch objektivierbarer Erfahrungsbedingungen (Urmeter, Referenzmaterialien, mustergültige Prototypen, Industrienormen, Kontrolltechniken, Prüfverfahren, Probemessungen usf.). Diese wiederum sind verbal festgeschrieben (O-MS) in Regulierungen von Zünften, Gilden, Berufsständen, in Gewerbe- und Handwerksordnung, in Lebensmittelrecht, Medizinrecht, Umwelt- und Tierrecht, Baurecht, Handelsrecht, Versicherungsrecht, Waffenrecht, Verkehrsrecht, Sportrecht, Urheber/Marken/Patentrecht etc., und wurden im Laufe der Wirtschaftsgeschichteunablässig umkämpft. (An anderer Stelle schlage ich vor, den gesamten Bereich sozial koordiniert erzeugter Objekte, welcher der begrifflichen „Kultur“ und dem metabegrifflichen „Recht“ vorgelagert ist, als eine von drei Soziofakt-Komponenten unter dem Begriff „Wirtschaft“ zusammenzufassen)
- in Texten der vergleichenden Rechtswissenschaften(sowohl in historisch längs- als auch in systematisch quergeschnittenen Vergleichen von Rechtsordnungen);
- in Linguistik / Semiotik(zum Stichwort „Sprachwandel“ gleich mehr);
- auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte(wenn man allein an die Bedeutungswandel eines Anschauungsbegriffes wie „Arbeit“ denkt, der in den vergangenen Jahrhunderten in Physik, Ökonomik, Philosophie, Soziologie, Jura zunehmend divergierende Verzweigungen und kriterielle Spezifikationen erfahren hat);
- bis hin zum Alles zu Allem in ein scheinbar objektives Verhältnis setzenden Meta-Medium Geld, das in jeder Phase seiner Geschichte immer wieder neue Formen kulturell wildwüchsiger Tausch-Objekte annahm, die dann, sofern in den Augen genügend (einfluss-)reicher Kreise einigermaßen praxisbewährt, früher oder später zu gesetzlichen Zahlungsmitteln erklärt wurden. Gegenwärtig vollzieht sich dieses Prozessprinzip bekanntlich im Anerkennen von Internet-Bezahldiensten und Krypto-currencies durch Fed, Banken, Börsen und Firmen und der davon getriebenen Vorbereitung digitaler Dollars, Euros, Kronen, Renminbis usw.

Im Grunde würde es sich natürlich lohnen, schlichtweg jeden einzelnen Begriff, dem qua Gesetz oder institutionalisiertem Gebrauch eine spezifische normative Kraft verliehen ist, auf die speziellen historischen Bedingungen seines Aufstiegs in die Meta-Ebene ideologiekritisch zu untersuchen.
Begriffsübergreifend allerdings — also systematisch — ist der Umstand, dass und wie Verwendungen von Zeichen, insbesondere verbaler Sprache, regulative Selbstbezüge ermöglichen, ja schon von und seit Peirce ziemlich gut beschrieben worden — das heißt schon deutlich vor Einführung des Konzepts Metasprache durch Russell und Tarski (beides Peirce-Bewunderer).
Durch das Kriterium „Konventionalisiertheit“ erfasst Peirces‘ Zeichentyp „legi-sign / symbol“ nicht nur bereits das meta-sprachliche Potential rekursiver Kommunikation (= Zeichenverwender „verabreden“ mit Zeichen Regeln der Zeichenverwendung) und bezeichnet dabei sogar explizit die Implikation einer normativen, rechtlichen Bedeutung („legi“). Sondern er erklärt obendrein — durch die komplementäre Abgrenzung von zwei einfacheren, logisch vorgelagerten Zeichentypen („sin-sign / index“ und „quali-sign / icon“) — die Möglichkeitsbedingung der Transformation je „niederer“ in „höhere“ Zeichen.
Der Linguist Rudi Keller hat in seinen beiden großartigen Büchern Sprachwandel und Zeichentheorie (1990er) dieses bei Peirce noch eher statische Zeichen-Modell als ein konsequent dynamisch-evolutives reformuliert. Sowohl anhand vieler Beispiele aus der Geschichte (nicht nur im Deutschen), als auch anhand systematisch-logischer Argumente, stellt Keller das kausale Prozessmuster dar, welches der Möglichkeit, ja der Tendenz zur Metamorphose einfacherer, freierer Zeichentypen in komplexere, enger normierte zugrunde liegt.
Bemerkenswert ist schließlich, dass genau zu dieser Metamorphose von einem Peirce-Zeitgenossen aus ganz anderer Richtung geforscht wurde, nämlich von dem österreichischen Staatsrechtler Georg Jellinek, der in seinem rechtsphilosophischen opus magnum Allgemeine Staatslehre (1900) die berühmt gewordene Formel von der „normativen Kraft des Faktischen“ prägte. Jellinek traute der „faktischen“ kulturellen Praxis nicht nur die normative Kraft des Aufstiegs in einzelne Rechtsbegriffe zu, sondern sogar die Gründung bzw. den Umsturz ganzer Rechtssysteme (also die Kraft zum „coup“):
„Selbst da, wo die Entstehung eines Staates durch rechtliche Akte vorbereitet ist, fällt […] der Vorgang der Entstehung selbst außerhalb des Rechtsgebietes [gemeint ist: in den Bereich nicht rechtsverbriefter Normen]. Nicht minder sind tiefgreifende Änderungen im Bau der Staaten durch Gewaltakte vollzogen worden, durch Revolutionen und Staatsstreiche.“
Jellinek stellt hierzu fest, dass — wenn Gewohnheiten sich nicht als Normen halten oder als geltendes Recht festgeschrieben werden können — politische Umwälzungsprozesse zwar zumeist in offener Gewalt ausgetragen werden — also sozusagen unter Aufkündigung jedweder objekt- und metasprachlicher Symbolisierungssitten. Ein paar Seiten weiter aber umschreibt er, wie politische Stabilität sich als geltendes Recht fortwährend aus der Ebene von Öffentlichkeit und Kultur zu speisen und von dieser zugleich sich abzuheben hat:
„Energie oder Trägheit des Volkscharakters, Stumpfheit oder kritische Schärfe des öffentlichen Geistes, Fähigkeit der Machthaber, sich die Massen zu assimilieren, und was die tausendfaltigen historischen Umstände sonst sein mögen, die den einzelnen geschichtlichen Vorgang bestimmen, lassen kürzere oder längere Zeit verstreichen, ehe ein politisches Faktum als zu Recht bestehend anerkannt wird.“
Ein gutes Jahrhundert nach Jellineks Überlegungen hat sich deren Ausgangspunkt vom Faktischen erdrutschartig zum Post-Faktischen verschoben. Eine Hauptursache für diesen Kulturwandel wird vor allem im Aufkommen des Internets und der sozialen Netzwerke gesehen — in einem Epochenwandel in Kommunikationstechnologie und Medienwirtschaft.
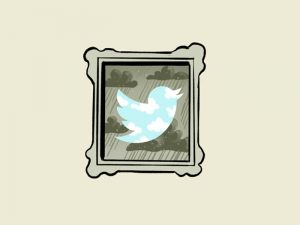
Politisch diskutiert wird daher gegenwärtig, wie die Metasprache des Rechts sich auf Unternehmen wie facebook und twitter eigentlich zu beziehen hat: Vermarkten sie ein bloßes Objekt — ein technisches tool, eine platform — oder sind sie Kuratoren objektsprachlicher Veröffentlichungen, und müssten daher medien- und datenschutzrechtlich reguliert werden.
Wie jede medienpolitische Debatte wird auch diese vor allem in jenem Medium geführt, das sie auslöste.
08.02.2021 — Rosa Mercedes / 02